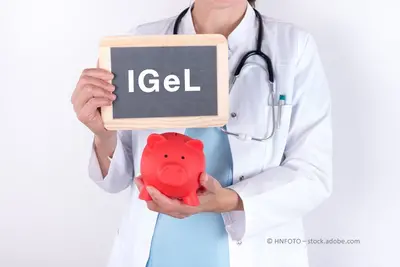Willkommen beim 12-fachen Versicherer des Jahres
Ihr Partner für Vorsorge, Versicherung und Kapitalanlage
Willkommen beim Münchener Verein
Vor mehr als 100 Jahren aus der Idee einer Selbsthilfeeinrichtung für das Handwerk und den Mittelstand gegründet, ist der Münchener Verein mittlerweile ein breit aufgestelltes Versicherungsunternehmen mit umfangreichem Produktangebot im Privat- und Geschäftskundenbereich.
Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit bleiben wir unserer Tradition treu und ermöglichen faire Prämien und nutzen ihre Beiträge zur Stärkung der Gemeinschaft, ohne dass Gewinne an externe Aktionäre gehen.
Versicherungen für Privatkunden
Versicherungen für Geschäftskunden

Ausgezeichneter Versicherungsschutz
mit dem 12-fachen Testsieger in Folge
Der Münchener Verein wurde in einer Kundenbefragung vom Deutschen Institut für Service-Qualität GmbH & CO. KG zum 12. Mal in Folge als "Versicherer des Jahres" gekürt. Dies bestätigt erneut die herausragende Qualität und Kundenzufriedenheit im Vergleich zu anderen Anbietern.
Ausgezeichnete Produkte
Unsere Stärken - Ihr Vorteil
Exzellenter Schutz und Service
Profitieren Sie von persönlichem Service und digitalen Lösungen. Unsere Beratungsangebote kombinieren Fachwissen mit der Flexibilität und Effizienz moderner Technologien, um Ihnen jederzeit und überall zur Seite zu stehen.
Unsere Gesundheits- und Pflegeversicherungen bieten Schutz in jeder Lebenslage. Mit prämierten Tarifen und individuellen Zusatzleistungen sichern wir Ihre Gesundheit umfassend ab – für ein sorgenfreies Leben.
Als verlässlicher Partner des Handwerks bieten wir spezielle Versicherungslösungen, die auf die einzigartigen Bedürfnisse von Handwerksbetrieben zugeschnitten sind. Wir unterstützen Ihr Unternehmen mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen.
Entdecken Sie die Bequemlichkeit unserer digitalen Services. Von der Online-Schadensmeldung bis zur Vertragsverwaltung über unsere App – erleben Sie effiziente und benutzerfreundliche Lösungen, die Ihren Alltag erleichtern.
Finden Sie schnell Antworten auf häufig gestellte Fragen. Unser umfangreicher FAQ-Bereich bietet Ihnen klare Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, damit Sie immer bestens informiert sind.
Wir sind immer für Sie da
Nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Rechnung scannen - fertig - los!
- Einfache und intuitive Bedienung
- Schnelle Bearbeitung und Rechnungserstattung
- Zeit und Portokosten sparen
Unser Ratgeber
Wissenswertes zum Thema Zahn, Gesundheit & Pflege

Zahnzusatzversicherung vom Testsieger
- Bis zu 100% Kostenerstattung
Für Zahnprophylaxe, Zahnerhalt, Zahnersatz und Kieferorthopädie - Sofort versichert
- Mit Innovationsgarantie
- Einfacher Wechsel
Anrechnung der Vorversicherung
Alle Presse-Informationen auf einen Blick

Mediathek
Bilder, Logos, Grafiken und Videos zum Münchener Verein und aktuelle Themen mit Versicherungsbezug finden Sie in unserer Mediathek.